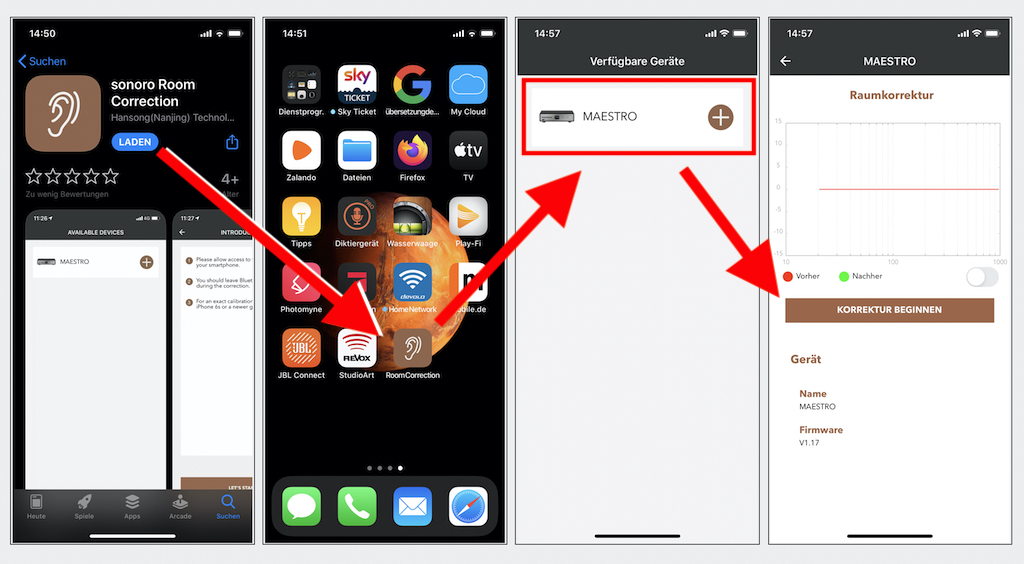Auf den ersten Blick sind die Smart Chrono SL 8 hübsche Lautsprecher. Tatsächlich verbirgt sich hinter der klassischen Lautsprecher-Fassade aber ein modernes HiFi-System inkl. Verstärker, DAC, Bluetooth- und WiFi-Streaming-Möglichkeit. Nervige Kabelei ist also nicht nötig und selbst physische Quellen werden nicht zwingend gebraucht. Klingt vielversprechend und zeigt sich in der Praxis als superpraktisch. Dazu kommen noch coole Heimkino-Skills. Auch das habe ich ausprobiert …
Die Zeiten großer HiFi-Türme sind in vielen Haushalten endgültig vorbei. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen haben die Leute keine Lust und keinen Platz mehr dafür. Zum anderen liegt die eigene Musiksammlung heutzutage eh auf dem Computer, auf NAS-Platten oder man streamt direkt aus dem Internet. Das heisst: Die moderne HiFi-Anlage besteht heute oftmals aus aktiven Lautsprechern und einem Computer oder Streamer. Diese Modernisierung treibt auch Canton mit seiner Smart-Serie voran – und geht sogar noch einen Schritt weiter: Alle Aktiv-Lautsprecher der Smart-Linie können nämlich wahlweise per Kabel oder auch drahtlos verbunden werden. Die Quelle wird dabei am Master angeschlossen, der dann den Slave mit entsprechenden Signalen versorgt – selbstverständlich kabellos.
Diese Vorgehensweise gilt für jeden Smart-Lautsprecher aus dem eigenen Portfolio, denn in allen großen Standmodellen stecken identisch ausgestattete Module. Folglich stellt sich die Frage, inwiefern sich die Smart Chrono SL 8 beispielsweise von der Smart GLE 9 unterscheidet.
Pluspunkt: Style
Beginnen wir beim Offensichtlichsten, beim Design: Die Smart GLE 9 ist rund 106,3 Zentimeter, die Smart Chrono SL 8 exakt einen Meter hoch. Mit 210 Millimetern ist die GLE zudem genau zwei Zentimeter breiter als die SL 8. Gegenüber dem klassisch-eckigen Auftritt der Smart GLE 9, kommt die Smart Chrono SL 8 dann eher gerundet daher. Harte Kanten sucht man im Kleid dieses Lautsprechers vergebens. Statt rechter Winkel, beispielsweise zwischen Schall- und Seitenwand, regieren hier sanfte Rundungen. Das wirkt in meinen Augen gefälliger, edler und auch anspruchsvoller.
Zur aufwändigeren Verarbeitung kommt dann noch die Oberflächenbehandlung: In der Smart GLE 9 setzt Canton auf ein unempfindliches Folienfurnier. Die Smart Chrono SL 8 kommt dagegen in mehrfach aufgetragenen, seidenmatten Schleiflackausführungen daher. Ein wesentlich aufwändigerer Vorgang, der aber auch optische Vorzüge genießt. Die SL 8 ist einfach schöner und wirkt auf den ersten Blick wertiger.
Mehr Flexibilität
Der dritte große, offensichtliche Unterschied findet sich im Gehäusedesign: In der Smart GLE 9 setzt Canton auf Tradition und spendierte dieser eine klassische Behausung mit rückseitigem Bassreflexport. Die etwas schlankere Smart Chrono SL 8 hingegen steht auf einer Basisplatte, die über vier sogenannte Spacer auf Abstand zum Gehäuse gehalten wird. Das hat optische und auch klangliche Gründe, denn die Austrittsöffnung sitzt in diesem Modell in der Gehäuseunterseite und strahlt ihre Klanganteile in definiertem Abstand auf die besagte Basisplatte. So konstruiert, verspricht sich die Smart Chrono SL 8 als flexibler in der Aufstellung. Warum man das nicht in der Smart GLE 9 gemacht hat? Ganz einfach, weil es einen komplexeren Korpusaufbau und andere technische Parameter erfordert (auf die ich gleich noch näher eingehe). Und das alles kostet soviel mehr Zeit, Aufwand und Geld, dass man den attraktiven Preispunkt der GLE 9 nicht im Ansatz hätte realisieren können.
Geführt und doch frei
Zu den offensichtlichen Unterschieden kommen die eher unsichtbaren: Das wäre in der Chrono SL 8 beispielsweise der aufwändigere Gehäuseaufbau. Stabile MDF-Wände, ein cleveres Mehrkammer-System und massive Verstrebungen versprechen eine absolut verwindungssteife Behausung. Punkte, die letztlich auch dem Klang zugute kommen sollen. Ein weiterer, eher auf den zweiten Blick sichtbarer, Unterscheid liegt im Hochtöner. Hier spendierte Canton seiner smarten Chrono-Standbox einen 25 Millimeter durchmessenden Tweeter mit Alu-/Keramikkalotte und Transmission Frontplate, der von einem sehr kraftvollen Magneten angetrieben wird. Der Hochtöner sitzt hier, geschützt von einem feinmaschigen Metallgitter, leicht vertieft im Zentrum der Transmission Frontplate, die ihr als eine Art Waveguide dient. Trotz dieser gezielten Schallführung verspricht Canton ein ausgeglichenes Rundumstrahlverhältnis. Bei dieser Hochton-Konstruktion handelt es sich übrigens um einen altbewährten Aufbau, der in ganz ähnlicher Form auch in der Vento-Linie, also der zweitgrößten Passiv-Serie Cantons, zum Einsatz kommt.
Schnell und kräftig
In den weiteren Wegen setzt Canton ebenso auf Altbewährtes, auf Titanium. Die Weilroder bezeichnen damit den dreilagigen Verbund aus Titan und Aluminium. Diese Konstruktion ist beispielsweise deutlich aufwändiger und teurer als die Bestückung in der Smart GLE 9. Zugleich ist sie aber auch steifer und leichter. Das alles macht das Schwingverhalten des 160er-Mitteltöners in der Smart Chrono SL 8 besser kontrollierbar. Hinzu kommt, dass Hoch- und Mitteltöner so eng wie möglich beieinander sitzen, wobei der Mitteltöner oben thront. Diese Anordnung hat bei Canton Tradition. Unterhalb dieser Kombi thront dann die Bass-Abteilung. Sie besteht hier aus zwei jeweils 160 Millimeter Basstreibern im eigenen Gehäuseabteil. Allen drei großen Chassis spendierte Canton übrigens seine nochmals überarbeitete Wave-Sicke. In der Chrono SL 8 ist sie nun dreifach gefaltet. Das wiederum verspricht ein fehlerfreies Ein- und Ausschwingverhalten bis hin zum Maximalhub und somit äusserste Präzision und jede Menge Kraft.
Smarte Sektion
Identisch ist in beiden Modellen hingegen die smarte Aktivsektion. Mit je 350 Watt liefert jede Smart Chrono SL 8 zunächst einmal genug Leistung, um auch Abhörräume bis zu einer Größe von 40 – 50 Quadratmetern locker mit Konzertpegeln zu füllen. Neben leistungsstarken Endstufen hat jede SL 8 dann noch einen eigenen Vorverstärker inkl. Quellverwaltung und umfangreicher Einstellmöglichkeiten an Bord. Das bedeutet, man könnte diesen Lautsprecher theoretisch auch autark verwenden. In besagten Einstellmöglichkeiten kann man dann beispielsweise die Wiedergabeart (Stereo, Music, Movie) bestimmen, Angaben zur automatischen Laufzeitkorrektur hinterlegen, einen Sleeptimer aktivieren, Lippensynchronität anpassen, weitere Smart-Lautsprecher koppeln, die gewünschte Quelle wählen bzw. individuell benennen oder die Lautstärke justieren. All das wird dann über das kleine aber sehr gut ablesbare Display im Fuß des Lautsprechers kontrolliert. Die Befehligung all dieser Einstellungen erfolgt über eine, mit nur 17 Tasten übersichtlich gestaltete, Infrarot-Fernbedienung, die jedem Master-Lautsprecher beiliegt.
Anschlussvielfalt
Die Verkabelung zwischen den beiden Lautsprechern entfällt hier vollständig. Aufgestellt und mit Strom versorgt, wird zunächst der Master über einen Kippschalter eingeschaltet. Nach etwa 6-8 Sekunden ist er dann für die kabellose Paarung bereit, so dass der zweite Smart Chrono SL 8 ebenfalls eingeschaltet werden kann. Ist das geschehen, verbinden sich beide Lautsprecher kurz darauf vollautomatisch. Die erfolgreiche Paarung wird nun mit den Lettern „CON“ in den Displays beider Chronos angezeigt.
Wird dem Master nun ein Quellsignal zugespielt, werden die für den Slave benötigten Klanganteile kabellos an ihn übermittelt. Anschließend geben beide SL 8 die Musik absolut zeitkorrekt wieder. Alternativ kann man seine Quelle aber auch am Slave anschließen. Das funktioniert, weil beide Lautsprecher mit je einem koaxialen und optischen Digitalzugang, sowie je einem Cinch- und XLR-Eingang ausgerüstet sind. Nur beim Master kommt noch ein USB-Port für den Anschluss eines Computers oder einer anderen digitalen Quelle dazu.
Die Smart Chrono SL 8 ist kabellos und individuell
Welcher Eingang gerade gewählt ist, auch darüber gibt dann das erwähnte Display Auskunft. Alternativ kann aber sogar ganz auf kabelgebundene Zuspieler verzichtet werden. Zum Beispiel lässt sich das Smartphone, Tablet, der Computer und sogar der neue OLED-Fernseher per Bluetooth konnektieren. Wie das funktioniert, darauf gehe ich gleich im ersten Teil meines Praxistests näher ein.
In diesem Zusammenhang noch ein wichtiger Punkt: Auf der Fernbedienung findet sich die Taste „Play Mode“. Über sie ruft man vorinstallierte Klangpresets für Stereo, Music und Movie ab. Wann welcher Modus verwendet wird und welche Auswirkungen er auf den Klang hat, auch dazu später mehr. Ein Fingertipp auf die Taste „Sound“ erlaubt dann noch die individuelle Klanganpassung. Die funktioniert in der Smart Chrono SL 8 übrigens sowohl im Hochton, im Mittelton und Bassbereich in jeweils 12 Stufen.
Feste Verbindung
So, die physischen Unterschiede sind genannt. Jetzt möchte ich wissen, inwieweit die Chrono SL 8 klanglich punkten kann. Diesbezüglich steht zunächst der Test als klassischer Aktiv-Lautsprecher an. Danach lasse ich die beiden hübschen Schallwandler noch kabellos mit dem kürzlich von mir getesteten Canton Smart Connect 5.1. kommunizieren.
Den ersten Testabschnitt starte ich dann ganz einfach und verbinde ich Chronos per Bluetooth mit meinem Smartphone. Für die Kopplung drücke ich die M-Taste auf der Fernbedienung und navigiere zu „WIS“, um dort „Bluetooth“ auszuwählen. Das Display zeigt nun: „Bluetooth koppeln“. Anschließend gibt sich der Master-Lautsprecher in der Liste verfügbarer BT-Spielpartner auch schon als „SL 8“ zu erkennen. Dieser Vorgang ist übrigens nur ein einziges Mal vorzunehmen. Sind Smartphone und Smart Chrono SL 8 einmal miteinander gepaart, genügt künftig der Druck auf die Bluetooth-Taste und schon kann die auf dem Handy gelagerte Musik sofort über die Lautsprecher wiedergegeben werden.
Musik liegt in der Luft
Auf dem Handy liegen in der Regel hauptsächlich MP3-Dateien. Das ist auch bei meiner portablen Musiksammlung der Fall. Und damit werden die Smart Chrono SL 8 nun gefüttert. Den Anfang macht Madonna mit „Medellin“: Einem Song, der nach eher langsamem Intro schnell Fahrt aufnimmt. Diese „Fahrt“ wird dann sofort imposant in den Hörraum übertragen. Straffe Elektrosounds zeichnen eine klare Atmosphäre. Die Hintergrund-Kombo sorgt zugleich für Gefühl, während Madonna das ganze mit ihrer unverkennbaren Stimme garniert. Obwohl eher unspektakulär, strotzt dieser weniger bekannte Song der Pop-Diva nur so vor Energie. Diese Energie sorgt dann auch dafür, dass mein Test-Duo aus dem Stand zu Höchstleistungen aufläuft. Pulsierende Elektrobeats, der Hall in Madonnas Stimme und intensive Grundtonaktionen füllen den Hörraum. Allem voran beeindruckt mich die wirklich hohe Grundtonimpulsivität. Dass das eine MP3-Aufnahme sein soll, werden hier nur die allerwenigsten raushören – ich gehöre zugegebenermaßen nicht dazu.
Temperament und Dynamik
Anschließend sollen sich die Cantons dann am Smart Connect 5.1 beweisen. Mit Daft Punks Elektro-Hymne „Get Lucky“ streame ich zunächst einen Titel in CD-Auflösung zu. Agile Elektro-Beats füllen den Raum. In Verbindung mit den straffen Oberbässen ergibt sich so ein Klangbild, das sofort Spaß macht. Und das sofort ins Blut übergeht. Die vielen kleinen Beats im Hintergrund werden dabei auch von der temperamentvollen Spielweise der Chronos nicht verdeckt. Nicht minder beeindruckend sind die satte Grundtondynamik und eine wirklich feine Auflösung, die vor allem im Mittenbereich kaum zu überbieten ist. Tonal liefern meine Testgäste jetzt einen kaum greifbaren Charakter, außer dem, dass sie einfach direkt und saftig durchspielen. Was noch auffällt ist die Neutralität und Präzision, mit der die Smart Chrono SL 8 zu Werke geht und echte Live-Atmosphäre erzeugt. Keine Spur von Markenklang. Stattdessen werde ich von der reinen, offensichtlich unverfälschten Wiedergabe der zugeführten Musik umhüllt.
Eine Frage des Geschmacks
Interessant wird es, als ich zwischendurch mal die bereits erwähnte Taste mit der Aufschrift „Play Mode“ ausprobiere: Ein kurzer Druck bestätigt mir, dass die Smart Chrono SL 8 gerade im Stereo-Modus spielt. Nach einem weiteren Fingertipp auf den gummierten Knopf wechselt das Setup auf „Movie“. Die Änderung wird umgehend hörbar, die Klangbühne sofort deutlich verbreitert. Sie reicht nun bis an die Seitenwände meines Hörraumes. Dieses „Aufspannen“ geht zwar ein wenig zu Lasten der akustischen Ordnung, beeindruckt aber durch Raum, Tiefe und einen schlichtweg fülligeren Sound. Ein Modus, der in etwa mit dem „Virtual Surround“-Mode vergleichbar ist, den man heute von vielen Soundbars kennt. Und der sich meiner Meinung nach optimal für die Wiedergabe von Filmen oder Live-Musik eignet. Wer also gern Live-Konzerte streamt oder eine entsprechende Blu-ray-Sammlung besitzt, für den wird dieser Modus sich als ideal darstellen.
Music oder Stereo?
Ein weiterer Druck bringt den Wechsel auf „Music“. Jetzt wird das Klangbild wieder etwas schmaler. Etwas schmaler ist für die klassische Musikwiedergabe von CD oder Spotify aber genau richtig. Zumindest für meinen Geschmack. Nach dem direkten Vergleichshören habe ich diesen Modus nämlich für mich als ideal zum Musikhören entdeckt. Die Bühne stellt sich jetzt etwas breiter dar als im Stereo-Modus. Das macht das Klangbild luftiger, räumlicher und nachvollziehbarer. Zugleich geht dabei aber auch nicht zu viel von der akustischen Ordnung verloren. In Sachen Staffelung und Präzision ist der Stereo-Mode zwar zu bevorzugen, dafür wirkt die gesamte Präsenz im Preset „Music“ lebendiger und greifbarer. Diesen Kompromiss gehe ich gern ein. Aber letztlich ist auch das eine Sache des Geschmacks. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen am besten gefällt. Kaputtmachen kann man nichts, jede Einstellung lässt sich mit einem Knopfdruck wieder ändern.
Realistische Natürlichkeit
Im nächsten Testabschnitt geht es dann deutlich ruhiger zu, dennoch wird dieser in der Disziplin Räumlichkeit zu einer weiteren imposanten Darstellung. Im Ray-Brown-Trio-Klassiker „Summertime“ werden Stimmen und Instrumente von meinem Kabellos-Duo sofort, ohne Umschweife und in ihrer ganzen Natürlichkeit dargestellt. Instrumente und Musiker sind akustisch sauber im Hörbereich – zwischen und über die physikalischen Standpunkte der Lautsprechern hinaus – abgebildet. Es ist, als würde die Musik neben, hinter und zwischen den Cantons spielen. Das können andere Setups auch, nur werden Instrumente dann oft auch mal gern übergroß dargestellt. Das ist zwar im ersten Moment imposant, genau genommen aber falsch. Bei der Wiedergabe über die Smart Chrono SL 8 ist das ausdrücklich nicht so. Hier behalten sämtliche Instrumente ihre korrekte Größe. Nichts wirkt übertrieben oder aufgebauscht, sondern einfach nur echt und wird zu einer Performance, die sofort den Eindruck vermittelt direkt vor der Live-Bühne zu sitzen.
Leichtfüssig und zielgerichtet
Den gleichen Effekt erlebe ich kurze Zeit später, als ich auf „Ever Fallen In Love“ von Nouvelle Vague wechsle. Einem ohne jegliche elektrische Unterstützung vorgetragenem Cover des Fine Young Cannibals-Klassikers. Und eins das eher leise, zugleich aber auch schwung- und druckvoll in unseren Hörraum gestellt wird. Auch jetzt finden sich die akustischen Gitarren und die Percussions gleichmäßig hinter der Sängerin im Raum verteilt wieder. Dabei wird ein Klangbild aufgespannt, das trotz fast fühlbarer Dynamik nichts von seiner Leichtigkeit einbüsst. Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Die Smart Chrono SL 8 zeigen stattdessen eine weitere Stärke auf, indem sie durch durch ihre offene und unglaublich präzise, aber nicht aufdringliche Höhenwiedergabe brillieren. Das sich der Tiefbassbereich dabei weiterhin dynamisch und trocken herausgestellt, ist fast schon Ehrensache. Im Ergebnis erlebe ich so ausgewogene Musikalität, weitreichende Räumlichkeit und eine klanglich detaillierte und interessante Alternativ-Version dieses 80er-Jahre-Klassikers.
Unspektakulär richtig
Mit der 2.0-Version „Die Mensch-Maschine“ – von Kraftwerks 3D – Der Katalog-Blu-ray – geht es anschließend deutlich handfester zur Sache. Jetzt will ich erfahren, was passiert, wenn die Ärmel hochgekrempelt werden müssen.
Die Antwort ist schnell gegeben und ebenso ungewöhnlich wie imposant: Zunächst einmal sprühen meine Testgäste nur so vor Kraft und Dynamik. Besonders beeindruckend ist der ausgeprägte Grundton, der ordentlich knallt und die kurzen Oberbässe impulsstark in den Raum drückt. Dazu kommt eine ordentliche Portion Tiefgang, die sich in der Magengegend bemerkbar macht. So muss der Sound kommen! Das macht mächtig Spaß und fordert unweigerlich einen kräftigen Rechtsdreh am Lautstärkeregler ein. Deutlich oberhalb der Zimmerlautstärke fühlen sich die Cantons dann ebenso wohl. Trotz des nun deutlich höheren Pegels ist die Mittenwiedergabe weiterhin sauber und brillant. Und sie ist im besten Sinne unspektakulär, sondern offenbar einfach richtig. Ein besseres Kompliment kann man einem Aktiv-Lautsprecher kaum machen …
Smart Chrono SL 8 im Heimkino
Apropos Blu-ray: Eingangs erwähnte ich ja den angeschlossenen Smart Connect 5.1. Er fungiert in meiner Testkette quasi als Vorverstärker und Quellenverwaltung. Zugleich bietet er nahezu alle Funktionen, die man von AV-Receivern kennt. Das funktioniert auch, ohne dass man fünf Lautsprecher angeschlossen haben muss. Hat man, wie ich, nur zwei Schallwandler verbunden, dürfte die Funktion „3D Audio“ besonders interessant sein. Einmal aktiviert, rechnet der Smart Connect 5.1 ihm zugelieferte Mehrkanal-Tonspuren – selbstverständlich auch Dolby Atmos und DTS HD – auf die beiden Wiedergabe-Kanäle um. Im Grund genommen handelt es sich dabei um eine Art Virtual Surround. Exakt das habe ich auch mit den Chrono SL 8 ausprobiert. Mit einem Ergebnis, das um Klassen effektiver und raumgreifender ist, als ich das bislang von jedem AV-Receiver in diesem Modus gehört habe. Wie sich das im Detail darstellt, erfahren Sie in meinem Test des Smart Connect 5.1.
Fazit
Die Smart Chrono SL 8 bringt viel mehr mit, was man heutzutage von einem modernen Aktiv-Lautsprecher erwartet. Diese Schallwandler beinhalten leistungsstarke Verstärker, einen DAC, ein Bluetooth-Modul und sind perfekt fürs HiRes-Streaming, sowie den Multiroom- und Heimkino-Einsatz vorbereitet. Bis auf die Verbindung zur Steckdose muss dazu nicht ein einziges Kabel verlegt werden. Selbstverständlich stehen aber auch entsprechende Anschlüsse für kabelgebundene Quellen wie Streamer, Computer, CD- oder Blu-ray-Player zu Verfügung. Zur Ausstattung kommen ein gefälliges, wohlproportioniertes Design und eine Verarbeitung, die man bei genannter Ausstattung in dieser Preisklasse sonst nur selten findet. Klanglich spielt die Smart Chrono SL 8 ebenfalls ganz vorn mit und offeriert ein Höchstmaß an Kraft, Agilität und Räumlichkeit. Wer mit dem Gedanken spielt, seine betagte HiFi-Anlage gegen ein modernes, raumsparendes, schickes und zukunftssicheres All-in-One-Setup zu ersetzen, sollte sich diese smarten Aktiv-Speaker unbedingt mal ansehen und anhören.
Test & Text: Roman Maier
Fotos: Philipp Thielen
Klasse: Spitzenklasse
Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten
| Modell: | Canton Smart Chrono SL 8 |
|---|---|
| Gerätekategorie: | Standlautsprecher, aktiv |
| Preis: | 3.000 Euro / Set (=Master-/Slave-Paar) |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Ausführungen: | - Schwarz Seidenmatt - Weiß Seidenmatt |
| Vertrieb: | Canton, Weilrod Tel.: 06083 / 2870 www.canton.de |
| Abmessungen (H x B x T): | 1000 x 190 x 300 mm |
| Gewicht: | 19,4 kg/St. |
| Prinzip: | aktiv, 3-Wege, Bassreflex |
| Hochtöner: | 1x 25 mm, Alu Oxyd Keramik |
| Mitteltöner: | 1x 160 mm, Titanium |
| Tieftöner: | 2x 160 mm, Titanium |
| Übertragungsbereich: | 24 - 30.000 Hz (Herstellerangabe) |
| Leistung: | 350 Watt pro Lautsprecher (Herstellerangabe) |
| Eingänge: | 1x Analogeingang (Cinch) 1x Bluetooth 3.0 aptX 1x Digitaleingang (koaxial) 1x Digitaleingang (optisch) 1x USB-Eingang 1x XLR (Balanced) |
| Ausgänge: | 1 x Digital (koaxial) |
| Dekoder: | - Dolby Audio - DTS Digital Surround - Virtual Surround - Virtual Center im 4.0-Heimkinobetrieb |
| Maximale Samplingrate/Auflösung: | PCM 96 kHz/24 Bit |
| Lieferumfang: | - 1x Smart Chrono SL 8 (Master) - 1x Smart Chrono SL 8 (Slave) - Fernbedienung - Netzkabel - optisches digitales Audiokabel (3,0m) - koaxiales digitales Audiokabel (3,0m) - analoges Stereo Audiokabel (3,0m) - Bedienungsanleitung |
| Pros und Contras: | + schnelle Installation + kabellose Übertragung zwischen beiden Lautsprechern + Laufzeitkorrektur + leistungsstarke Verstärker + LipSync-Funktion + Voice-Funktion + Klanganpassung + 3 Klangpresets + Dekoder für DTS und Dolby Audio + punchige Grundtondarstellung + USB-Wiedergabe von PC & Co + sehr gute Verarbeitung + übersichtliche Fernbedienung |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 94/95 |
| Praxis (20%): | 94/95 |
| Ausstattung (20%): | 95/95 |
| Gesamtnote: | 94/95 |
| Klasse: | Spitzenklasse |
| Preis-/Leistung | sehr gut |
Der Beitrag Canton Smart Chrono SL 8 – Kabellos und elegant in die moderne HiFi-Welt erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.