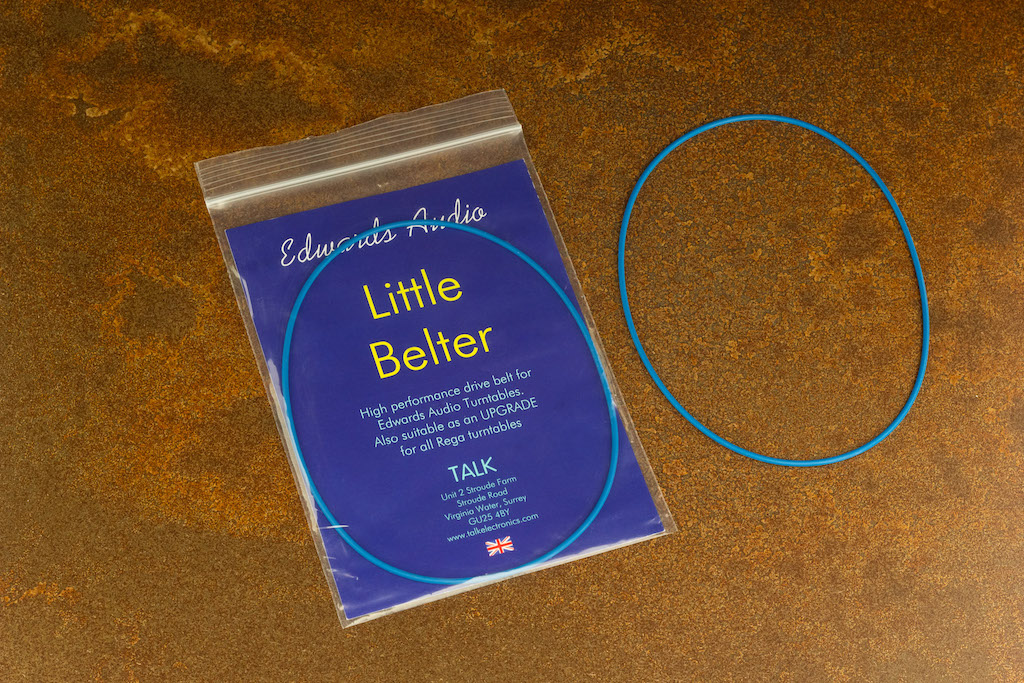Einsen und Nullen sind die Basis unseres heutigen Musikgenusses. Der B.M.C. Audio UltraDAC setzt deshalb konsequent auf digitale Datenzuspielung – und verwandelt dieses Rohmaterial in edlen Klang: Sein DAC konvertiert HiRes-Files der Formate PCM, DSD und sogar DXD, sein Pre-Amp liefert Feinkost für eine Endstufe, sein Kopfhörer-Verstärker stellt die Musik fix und fertig für Muschelträger bereit. Der Qualitäts-Clou: Der Audio-Output ist komplett symmetrisch.

Modern und markant: Der B.M.C. Audio UltraDAC glänzt optisch mit seiner Kombination aus Aluminium-Gehäuse, verspiegelter Front und Display-Illumination.
Es gibt Marken mit Markanz, die erkennt man auf den ersten Blick. Der High-End-Hersteller B.M.C. Ist hier ein Paradebeispiel: Vom CD-Spieler bis zum Verstärker sind sämtliche Produkte des Portfolios frontseitig von dem zentralen, hervorragenden Bullauge geprägt. Diese Formsprache ist auch im Firmenlogo der Berliner stilisiert – und im B.M.C. Audio UltraDAC in reinster Ausprägung dreidimensionalsiert. Hier zieht wird dir Rundung des frontalen Bullauges über die gesamte Gehäusedecke hinweg bis zur Rückseite fortgeführt, dies mutet wie das Mittelschiff eines flachen Klangtempels an. Die edle Erscheinung wird durch das goldenen Dekor bekräftigt, das deckenseitig die Rundung des zentralen Auges unterstreicht und als abschließende Applikation die Flanken vorn und hinten ziert. Doch es gibt noch mehr Markanz.

Goldkante: Vier goldene Applikationen markieren die vorderen und hinteren Enden der Gehäuseflanken.
Elektrisches Erweckungs-Erlebnis
Das zweite B.M.C.-Charakteristikum ist die Vollmetall-Fertigung: Das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. Front und Rückseite haben eine Wandstärke von mehr als acht Millimeter, und die Lüftungsschlitze auf der Gehäusedecke verraten uns, dass die Haube mit vier Millimetern Metall ebenfalls höchst solide ist. Eine innere Bedämpfung des Gehäuses sorgt für mechanische „Ruhe im Karton“. Der Materialeinsatz trägt natürlich zum Gewicht des B.M.C. Audio UltraDAC bei, er wiegt beachtliche 6,3 Kilogramm. Die Materialwahl ist außerdem mitverantwortlich für die hochwertige Erscheinung. Das dritte B.M.C.-Erkennungsmerkmal ist der verspiegelte Frontbereich samt der Inszenierung seiner Illuminierung. B.M.C. hat es geschafft, das Einschalten eines Geräts zu einem elektrischen Erweckungs-Erlebnis zu erheben. Mit dem Druck auf den An/Aus-Schalter beginnt die Erleuchtung des Geräts, plötzlich erscheinen im Spiegel wie aus dem Nichts die Bezeichnungen der Tasten und Schalter. Das zentrale Bullauge entpuppt sich nun als Runddisplay, es präsentiert uns das Firmenlogo und die Produktbezeichnung – und schließlich in großen Balken die Start-Lautstärke sowohl für den Vorverstärker als auch für den Headphone-Amp.

Das zentrale Display in Bullaugen-Anmutung ist ein Markenzeichen von B.M.C.Audio.
Verstärker-Doppel: Pre-Amp …
Die beiden Verstärker sind die sichtbaren Funktionseinheiten des B.M.C. Audio UltraDAC. Jedem der Amps ist eine Geräteseite gewidmet. Der linke Flügel repräsentiert den Vorverstärker. Hier finden wir frontseitig als erstes den An/Aus-Schalter für die Stromversorgung. Sie ist der zweite Gewichtstreiber des Geräts, gegenüber dem Netzteil des kleinen Bruder-Modell, dem PureDAC, ermöglicht sie eine um satte 70 Prozent größere Spannungsversorgung und damit eine stabilere Musikwiedergabe. Diese Leistungsfähigkeit, aber auch ein aufwändigeres Verstärkerkonzept, adeln unsere Version zum „Ultra“. Zurück zum Frontgeschehen: Die Musik, besser die Quelle, wählt man nun mit dem Input-Taster. Hier stehen die vier Schnittstellenarten AES/EBU, USB, S/PDIF Toslink und S/PDIF koaxial zur Verfügung. Die Potenz dieser Ports ergründen wir später im Abschnitt „Schnittstellen“. Nun folgt die Kernkompetenz, die Verstärkung: Mit den „Hoch“- und „Runter“-Tastern lässt sich die Lautstärke zwischen Null bis 66 verändern. Dahinter steckt eine ausgeklügelte Verstärkerschaltung und eine patentierte, verlustfrei arbeitende Lautstärkeregelung, die B.M.C. „Discrete Intelligent Gain Management“ getauft hat. Zuguterletzt finden wir den Mute-Schalter, mit dem der Verstärker stumm geschaltet wird. Ein sattes Relaisklacken deutet uns an, dass der Signalweg physikalisch komplett aufgetrennt ist.

Für Audiophile bietet der UltraDAC einen symmetrischen Audio-Ausgang in Form zweier XLR-Buchsen. Alternativ geht es auch unsymmetrisch über die beiden Cinch-Buchsen.
… und Kopfhörer-Verstärker
Nun zum rechten Flügel des B.M.C. Audio UltraDAC: Er ist allein dem Kopfhörerverstärker vorbehalten, der schaltungstechnisch völlig unabhängig vom Pre-Amp arbeitet und bedient werden kann. Dementsprechend besitzt der rechte Flügel seine eigenen Mute- und Lautstärke-Taster, und natürlich hat der Kopfhörerverstärker seinen eigenen Ausgang. Hier bietet der UltraDAC einen Leckerbissen: Zum üblichen unsymmetrischen Ausgang, der als Klinkenbuchse ausgeführt ist, finden wir einen symmetrischen Ausgang in Form einer vierpoligen XLR-Buchse. Symmetrische Ausgänge sind im Beschallungs- und Studio-Bereich seit vielen Jahren der Standard, weil sie die beste Übertragungsqualität gewährleisten: Das Signal wird über zwei Adern doppelt durch die Leiter geschickt, einmal normal, einmal invertiert. Durch diese sogenannte differentielle Übertragung lassen sich Störungen, die bei der Signalübertragung auf das Kabel eingewirkt haben, erkennen und bannen. Diese symmetrische Signalführung bietet der B.M.C. Audio UltraDAC beim Kopfhörer-Ausgang, aber ebenso beim Pre-Amp-Ausgang: So wird eine nachfolgende Endstufe bestmöglich bedient. Wer das Signal trotzdem unsymmetrisch abgreifen möchte oder muss, kann auch dies tun: Der B.M.C. Audio UltraDAC bietet dafür beim Vorverstärker-Ausgang zwei Cinch-Buchsen und beim Kopfhörer-Ausgang eine große Klinkenbuchse. Soweit die Verstärker – doch im Namen des Modells und unter der Haube des Geräts steckt eine dritte Kraft, die ganz am Anfang wirkt und Gutes schafft.

Der Kopfhörer-Verstärker glänzt ebenfalls mit einem symmetrischen Ausgang, aber auch hier steht als Alternative eine Klinkenbuchse für den unsymmetrischen Anschluss parat.
Klasse-Konverter mit Präzisions-Uhrwerk
Im Innern des B.M.C. Audio UltraDAC wirkt ein erlesener Digital-Analog-Umsetzer. Er ist das eigentliche Herz des Geräts, denn hier, am Anfang der Signalkette, entscheidet sich, wie es später um die Qualität des abgegebenen Musiksignals bestellt ist. Darum setzt B.M.C. auf einen Premium-Konverter, der die eingehenden Digitaldaten exakt verarbeitet und in ein möglichst artefaktfreies Audiosignal übersetzt. Damit das Timing stimmt, also Daten zum richtigen Zeitpunkt geliefert und gelesen werden, muss die Taktung beim Transport der Einsen und Nullen stimmen. Schwankt hingegen die Genauigkeit, dann kommt es zu Abtastfehlern, zu einem zeitlichen Taktzittern. Dieser sogenannte „Jitter“ nistet sich als Störsignal in die eigentliche Musikinformation ein. Mit einem Präzisions-Uhrwerk, das B.M.C. Audio „ReferenzClock“ nennt, wird dieser Jitter vermieden. Dadurch ist das Klangbild spürbar reiner und ruhiger. Wer einen Blick unter die Haube des B.M.C. Audio UltraDAC wirft, sieht das hier auch so bezeichnete „Uhrwerk“ als monolithisches Modul aus der Hauptplatine emporragen. Dieser Taktgeber ist aber eigentlich ein Doppel-Herz: Im Ultra DAC arbeiten gleich zwei Clock-Systeme, eines für 44.1 Kilohertz (das ist die Abtastrate für Audio-CD) sowie eines für 48 Kilohertz und dessen Vielfache, womit die Verarbeitung von HiRes-Files gewährleistet ist. Welcher Eingang des B.M.C. Audio UltraDAC nun welche hochauflösende Qualität akzeptiert, schauen wir jetzt.

Der UltraDAC bietet vier digitale Eingänge:1 x Cinch/koaxial, 1 x Toslink, 1 x USB-B und 1 x AES/EBU. Über die B.M.C. Link-Buchsen kann der UltraDAC mit Verstärkern von B.M.C. via Lichtleiter gekoppelt werden.
Ausschließlich digitale Schnittstellen
Der B.M.C. Audio UltraDAC richtet sich eindeutig an moderne Musikhörer, das verrät ein Blick auf die Rückseite: Die Eingänge sind samt und sonders digital. Hier werden alle Möglichkeiten abgedeckt: Für S/PDIF-Signale stehen ein elektrischer Koaxialeingang und ein optischer Toslink-Input zur Verfügung, hier werden PCM-Signale bis 192 Kilohertz/24 Bit akzeptiert. Hinzu kommt ein USB-Port mit Typ-B-Buchse für den Anschluss an den Computer. Der USB-Eingang ist asynchron, das bedeutet: Die Clock im UltraDAC gibt das Timing vor und sagt dem Computer, wann er wieviel Daten zu liefern hat. Dadurch ist der UltraDAC unabhängig von den Taktschwächen des Computers und seines USB-Busssystems, das verhindert Fehler in der Datenübertragung und die daraus resultierende Qualitätseinbußen. Über den USB-Port geht PCM bis 384 Kilohertz/32 Bit sowie DSD bis DSD128, hinzu kommt die Fähigkeit zur DXD-Wiedergabe. DXD ist das Kürzel für „Digital eXtreme Definition“, es wurde ursprünglich entwickelt, um DSD-Dateien komfortabel wie PCM-Audio-Dateien bearbeiten zu können. Mittlerweile wird DXD aber darüber hinaus auch als eigenständiges Format verwendet, es bietet eine noch bessere Dynamik als DSD und ist weniger kritisch im Rauschverhalten. Das alles geht also über den USB-Port, hier ist der UltraDAC mit Linux sowie Mac kompatibel, für Windows ist der ASIO-Treiber sogar schon enthalten.Krönender Abschluss der Anschluss-Seite ist der AES/EBU-Eingang. Das Kürzel steht für „Audio Engineering Society/European Broadcasting Union“, als Format zur Übertragung digitaler Audiosignale ist es hauptsächlich im professionellen Studio- und Rundfunk-Bereich zu finden. Der B.M.C. Audio UltraDAC bietet uns diese Schnittstelle als symmetrischen Eingang in Form einer XLR-Buchse. Das ist ein starkes Statement für den Qualitätsanspruch des UltraDAC. Zwei weitere Buchsen sind als „B.M.C. Link“ ausgewiesen. Sie sehen wie Toslink-Ausgänge aus, es sind auch Lichtleiter-Schnittstellen, doch sie dienen allein der Ankopplung eines nachfolgenden B.M.C. Leistungsverstärkern wie zum Beispiel des PureAmp. Über diesen Weg soll die Geräte-Kombination eine noch bessere Klang-Performanz bieten.

Zehn, neun, acht …: Nach dem Einschalten beginnt das Warm-Up mit einem Countdown, danach ist der B.M.C. Audio UltraDAC startklar.
Countdown zum Wohlklang
Wer den UltraDAC einschaltet, erlebt nicht nur die Illumination der Front, sondern sieht zudem in der zentralen Bullaugen-Anzeige ein Runterzählen von Zehn bis Null. Das geschieht sowohl auf der Pre-Amp-Seite als auch auf der Headphone-Seite des Displays. Dies ist der Countdown zum Wohlklang. Danach ist der B.M.C. Audio UltraDAC startklar und beginnt mit seiner Grundlautstärke. Sie ist mit „10“, sehr moderat bis leise. So ist gewährleistet, dass bei beiden Einsatzmöglichkeiten – also im Rahmen einer Klangkette mit einer Endstufe oder aber allein mit einem Kopfhörer – das Ohr immer mit einem gehörschonenden Anfangspegel beschallt wird. Prima! Wir starten die Beschallung im Kopfhörerbetrieb. Mit dem Audeze LCD-CX, den wir letzte Woche getestet haben, steht uns ein perfekter High End-Spielpartner zur Verfügung. Wir können mit ihm sowohl den symmetrischen Ausgang der Headphone-Sektion testen als auch über einen Adapter den unsymmetrischen Ausgang. Dafür spielen wir den Fackeltanz op. 51 von Moritz Moszkowski zu. Moszkowski war ein deutsche Spätromantiker, er galt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als einer der großen Komponisten seiner Zeit, heute hingegen ist er leider so gut wie vergessen. Doch der Dirigent Martin West und das San Francisco Ballet Orchestra rufen uns den Romantikers wieder in Erinnerung. In der erstklassig produzierten Einspielung erweist sich Moszkowskis Feuertanz als tolles Orchesterstück, beim Wechsel vom unsymmetrischen zum symmetrischen Eingang wird daraus sogar ein funkensprühendes Fest der Sinfonik. Die Dreidimensionalität des Orchesters, zuvor schon exzellent, wird nun geradezu atemberaubend! Wir können die verschiedenen Instrumentengruppen wunderbar definiert heraushören und verorten, die einzelnen Instrumente gewinnen noch einmal an Griffigkeit – bis hin zu den ganz hinten platzierten Pauken. Auch in punkto Offenheit und Luftigkeit, wo der Magnetostat-Kopfhörer sehr sensibel Unterschiede aufzeigen kann, erweist sich der symmetrische XLR-Ausgang des B.M.C. Audio UltraDAC als überlegen. Hier klingt alles klingt noch müheloser, selbstverständlicher, einfach natürlich. Darum eine große Bitte: Wer die Möglichkeit hat, sollte unbedingt die symmetrische Variante wählen.

Zum B.M.C. Audio UltraDAC gibt es auch eine Fernbedienung. Der Befehlsgeber ist aus Kunststoff gefertigt und ergonomisch geformt, dadurch liegt er leicht und gut in der Hand. Diese RC-2 ist eine Systemfernbedienung, mit ihr können auch andere B.M.C.-Komponenten gesteuert werden. Für den Audio UltraDAC sind sämtliche Funktionen verfügbar, die auch am Gerät selbst eingestellt werden können.
Wir legen den Kopfhörer nun beiseite und nutzen den UltraDAC jetzt als Konverter/Pre-Amp-Duo. Auch das ist eine ausgezeichnete Klangveredelungs-Kombination, wie wir nach dem Austausch unseres bisherigen Hardware-Setups schnell feststellen. Wir erfahren das mit Musik von der norwegischen Sängerin und Liedermacherin Kari Bremnes, sie ist für ihre audiophil produzierten Alben bekannt. Durch die Qualität der Aufnahme kommt die Ausdrucksstärke ihrer Musik und gerade ihrer Stimme voll zur Geltung. Wir haben die mystisch-melancholische Nummer „Coastal Ship“ ausgesucht, der Track beginnt mit schweren Trommelschlägen, die sich nach mehrfachem Wiederhall in der Ferne verlieren, aber auch in den Tiefen der sphärischen Synthesizer-Sounds versinken, die zeitgleich die Atmosphäre intensivieren und ab und an durch einzelne hinzugefügte Klavierakkorde neue Klangfarben erlangen. Ein toller Anfang – und er wird mit dem Umstieg auf den B.M.C. Audio UltraDAC noch toller. Die Trommeln gewinnen jetzt an Volumen und fahren uns nun wie Donnerschläge in die Glieder. Uff! Das ist eine deutliche Steigerung in der Dynamik, aber auch im Bass, zugleich wirkt der Klang konturierter. Es dauert deutlich länger, bis die Trommelechos im Nichts verhallen. Die Wiedergabe hat also an Auflösung und Tiefe gewonnen, die Synthesizer-Klänge hüllen uns nun nahezu ein.

Erhabene Decke: Die Rundung des Bullauges wird auf der Gehäuseoberseite fortgeführt.
Dann beginnt der Gesang von Kari Bremnes. Diese klare, warme, fast feenhafte Stimme besitzt eine natürliche Kraft, sie trägt ohne jegliche Forcierung und steht sofort im Fokus. Mit dem UltraDAC gewinnt ihre Stimme abermals physische Präsenz: Wir hören nun selbst die allerzartest gehauchten Endungen, Konsonanten, die mit einem Rest an Atem die Lippen verlassen. Allein die Songzeile „dreaming by a fjord so deep“ ist schlicht zum Schwärmen und beschert uns mit dem finalen „p“ eine wohlige Gänsehaut. Dieser wunderschöne Gesang, eingebettet in ein mystisches Klanggewand, verschlägt uns schließlich den Atem. Vor lauter Faszination haben wir am Ende des Liedes unwillkürlich die Luft angehalten, bis die letzten Trommelschläge und die dunklen Sphärenklänge in der Unendlichkeit verschwunden sind. Das dauert Dank des immensen Auflösungsvermögens des B.M.C. Audio UltraDAC scheinbar eine Ewigkeit. Das Mehr an Auflösung beschert uns also einen intensiveren Musikgenuss.

Aktives USB-Audio-Kabel als Signal-Aufbereiter: Musik-Übertragung via USB kann eine knifflige Sache sein, gerade bei größeren Entfernungen. Das Digitalsignal, vom PC ursprünglich als akkurate Informationsfolge von sauberen Rechtecken losgeschickt, erleidet auf dem Weg durch das Kabel Störungen und Übertragungsverluste, es kommt schließlich ziemlich deformiert am USB-Eingang der Audiokomponente an. Die aktive Elektronik des B.M.C. PureUSB1 entfernt diese Signalverformungen und filtert zudem die USB-Versorgung. So erhält der DAC des Audiogeräts ein sauberes Signal, das verbessert hörbar den Klang. Preis: ab 290 Euro (zwei Meter) beziehungsweise ab 390 Euro (fünf Meter).
Dieser Zusammenhang leuchtet auch sofort ein, wenn man mit dem B.M.C. Audio UltraDAC eine Aufnahme erst in CD-Güte und dann in HiRes-Qualität hört. Wir wählen dafür den den Song „Dusty Groove“ von der Deep Funk-Band The New Mastersounds. Die Live-Einspielung aus dem Hamburger Kampnagel besitzen wir in 44,1 Kilohertz/16 Bit und in 192 Kilohertz/24 Bit. Das britische Quartett klingt schon in CD-Güte prima: Wir sind mitten im Publikum drin und nah an den Musikern dran, der Sound ist differenziert und durchsichtig. Jetzt der Wechsel zum HiRes-File – und prompt zeigt der UltraDAC die Unterschiede auf: Die funkige E-Gitarre, mit weichem Wah-Wah-Pedal gespielt, hat nun einfach mehr Grip, die ganze Band wirkt noch strukturierter. Wer auf die Snare des Schlagzeugs achtet, hört auf einmal mehr von dem Rasseln des Teppichs, er sitzt der unter dieser Trommel und sorgt für den typischen Charakter der Snare. So muss diese Trommel klingen! Mit dem HiRes-File und dem B.M.C. Audio UltraDAC sind wir also schlicht und einfach näher an der Natürlichkeit. So klingt es amtlich.

Perfect Match: Mit einem passenden Partner wie dem Auzeze LCD-XC kann der B.M.C. Audio UltraDAC die Qualität seines Kopfhörerverstärkers eindrucksvoll ausspielen.
Fazit
Wer für HiRes-Files plädiert, bekommt mit dem B.M.C. Audio UltraDAC eine High End-Argumentationshilfe. Er vereint einen ausgezeichneten Konverter, einen erstklassigen Vorverstärker und einen exzellenten Kopfhörer-Amp – und bietet damit eine audiophile Dreifaltigkeit, die hochauflösenden Files in hochtransparente, ultraklare und wunderbar natürlich klingende Musik verwandelt. Dabei geht über USB PCM 384 Kilohertz/32 Bit sowie DSD 128 und sogar DXD, die zwei S/PDIF-Inputs und die professionelle AES/EBU-Schnittstelle erlauben PCM 192 Kilohertz / 24 Bit. Für die bestmögliche Signalübertragung werden die Signale auch symmetrisch ausgegeben – sowohl für den Kopfhörer als auch für eine nachfolgende Endstufe. Den Premium-Klang mit Profi-Features präsentiert der B.M.C. Audio UltraDAC in einem elegant-markanten Gehäuse, so ist er Hingucker und Hinhörer zugleich.
Test & Text: Volker Frech
Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder
Klasse: Referenzklasse
Preis-/Leistung: gut

Technische Daten
| Modell: | B.M.C. Audio UltraDAC |
|---|---|
| Produktkategorie: | DAC / Vorverstärker / Kopfhörerverstärker |
| Preis: | 3.198,00 Euro |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Ausführungen: | Silber (Aluminium) |
| Vertrieb: | B.M.C. Audio GmbH Tel.: +49 30 / 692 006 061 www.bmc-audio.com |
| Abmessungen (HBT): | 103 x 365 x 328 mm |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Maximale Samplingraten/ Auflösungen | - S/PDIF (elektrisch, optisch) und AES/EBU: PCM 192 kHz / 24 Bit - USB: PCM 384 kHz / 32 Bit; DSD 128, DXD |
| Eingänge (digital) | 1 x Coax (S/PDIF elektrisch) 1 x Toslink (S/PDIF optisch) 1 x USB Typ B 1 x AES/EBU |
| Ausgänge (analog): | 1 x Line symmetrisch (XLR) 1 x Line unsymmetrisch (Cinch) 1 x Kopfhörer symmetrisch (XLR) 1 x Kopfhörer unsymmetrisch (Klinke, 6,35 mm) |
| Ausgänge (digital): | 2 x B.M.C. Link zum Anschluss an B.M.C.-Verstärker (Toslink) |
| Lieferumfang: | - B.M.C. Audio UltraDAC - Fernbedienung RC-2 - Batterien (2 x R03-AAA) - Netzkabel - Bedienungsanleitung mit Garantieerklärung (Englisch) |
| Besonderes: | - exzellente Klangqualität - Formatvielfalt und hohe Samplingraten/Auflösungen - als DAC, Vorverstärker und Kopfhörerverstärker einsetzbar - symmetrische und unsymmetrische Ausgänge - edel-markantes Design |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 1,0 |
| Praxis (20%): | 1,0 |
| Ausstattung (20%): | 1,0 |
| Gesamtnote: | 1,0 |
| Klasse: | Referenzklasse |
| Preis-/Leistung | gut |
Der Beitrag B.M.C. Audio UltraDAC – Audiophile Dreifaltigkeit mit DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Amp erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.